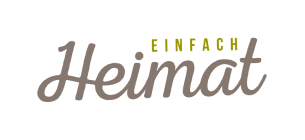Moin – mehr als ein Wort
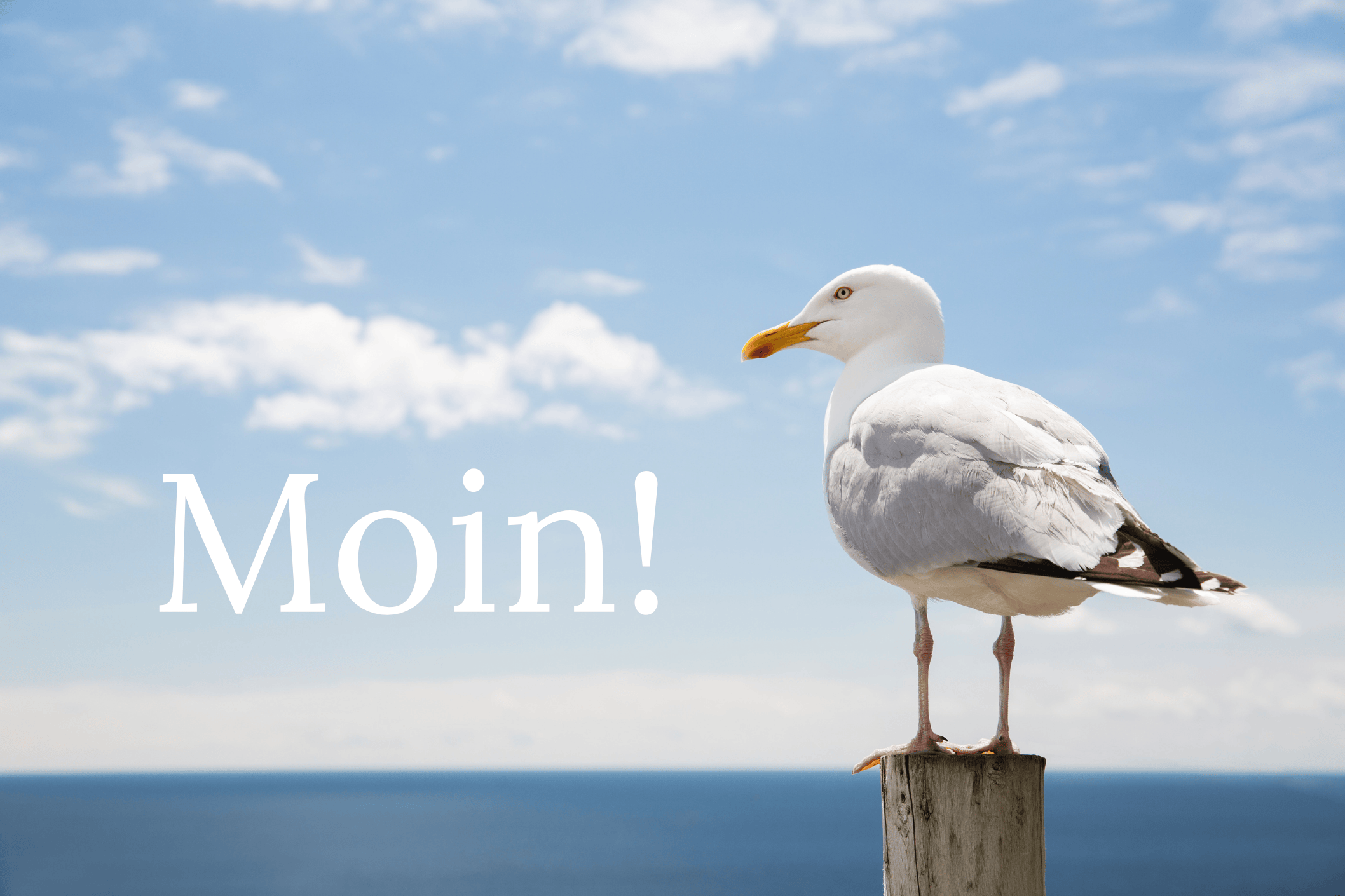
Ein Wort, das so viel bedeutet: „Moin“ sagen wir Norddeutschen am Morgen, am Mittag und am Abend. Der Tonfall verrät zwischen den Zeilen unsere Stimmung. Die Länge, wie wichtig und herzlich uns eine zwischenmenschliche Begegnung gerade ist. Ein „Moin“ ist mehr als nur ein Wort – es ist ein echtes Lebensgefühl.
„Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend“ – das waren die guten Umgangsformen in einem nordrhein-westfälischen Dorf, die mir als Schulkind beigebracht wurden. Dann zogen wir zwei Jahre später nach Niedersachsen – und unsere neuen Nachbarn begrüßten uns mit einem mir unbekannten Wort. „Moin“ riefen sie am helllichten Tag über den Gartenzaun. Es klang freundlich, sie lachten und winkten dabei. Aber ich wusste nicht, was sie meinten und blickte mich um. Scheu winkte ich zurück und rief „guten Tag“. Sie lachten erneut und gingen ins Haus – aber nur, um Begrüßungsgetränke zu holen und uns ab sofort in ihrer Straße und ihrem Leben willkommen zu heißen. Das war meine erste Begegnung mit dieser besonderen Grußformel, die so viel mehr ist, als das. Sie ist eine universelle Allzweckwaffe, die Stimmung und Wertschätzung zwischen den Zeilen transportiert.
Heute, rund 30 Jahre später, ist das „Moin“ mein ständiger Begleiter im Alltag. Es kommt mir immer wieder wie von selbst über die Lippen, ist in Fleisch und Blut übergegangen, ein Teil von mir. Ich kann mir ein Leben ohne diese vier Buchstaben nicht mehr vorstellen. Und dieser Gruß hat so viele Vorteile: Ich muss mir keine Gedanken über die Uhrzeit machen, es ist zu jeder Tages- und Nachtzeit angebracht. Kein lästiges „guten Morgen“, „guten Mittag“ oder „guten Abend“ mehr, verbunden mit einem Blick auf die Armbanduhr. Jede und jeder versteht es und erwidert es entsprechend. Man kennt sich auf dem Land und grüßt sich. Zumindest die Alteingesessenen.
Nicht jedes „Moin“ ist gleich
Aber wer den Eiheimischen lauscht und nun denkt, jedes „Moin“ sei gleich, irrt gewaltig. Denn dieses Wort ist eine wahre Wunderwaffe. Auch ich habe es im Laufe der Jahre für mich perfektioniert und akzentuiert – aber mehr unbewusst als bewusst. Das kurze knackige „Moin“ ist der Standard bei uns, es wird zu jeder Zeit genutzt. Das geschwätzigere „Moin, moin“ sagt man vielleicht in anderen Regionen, aber hier im Ammerland ist das höchstens ein Indiz für Touristen. Ein kurzes, kräftiges „moin“ sagt eigentlich alles aus: „Sei gegrüßt, hallo, guten Tag.“ Vielleicht noch kurz die Hand zum Gruße gehoben. Und jeder geht wieder seines Weges. Bei einem geknurrten „moin“ ist derjenige eventuell mit dem falschen Bein aufgestanden oder es besteht eine Unstimmigkeit zwischen Personen – aber das machen die eh unter sich aus.


Anders sieht es bei dem zweisilbigen „mo-hoin“ aus: Das verwende ich, wenn ich jemanden öfter oder regelmäßig sehe, eventuell auch schon mal am selben Tag getroffen und bereits gegrüßt habe. Dazu gibt es manchmal ein schnelles Küsschen auf die Wange oder einen kurzen Handschlag. Alles kann, nichts muss.
Wenn ich hingegen überrascht bin, jemanden an einem bestimmten Ort zu treffen, oder wir uns lange nicht begegnet sich, strecke ich das Wörtchen, flöte es nahezu, manchmal noch mit einem vorangestellten und verblüfften „ja“ verbunden: „Ja, mooooin“. So klingt es dann sehr melodisch, oftmals verbunden mit einer herzlichen Umarmung, einem kräftigen Handschlag oder Schulterklopfen, je nachdem, wie innig man miteinander verbandelt ist. Meist bleibt man dann noch eben für einen kurzen „Schnack“ stehen.
Mittlerweile hat sich eine weitere interessante Form entwickelt: „moinsen“ oder auch das „Moin, Leude“. Diese Formel ist bei uns unter Junggebliebenen und Jugendlichen verbreitet und wird häufig im Freundeskreis verwendet.
Achten sollte man nicht nur auf die Tonlage, sondern auch auf die Mimik: Wer beim „moin“ lächelt, meint es auch so. Wer dabei ernst schaut oder keine Mine verzieht, hat entweder schlechte Laune, ist in Eile oder für den ist die gegenseitige Bindung nicht so eng. Oder derjenige hat gerade einfach nicht über seine Mimik nachgedacht. Schließlich ist nicht jeder ein Moin-Perfektionist.
Ein kurzes, stummes Nicken von Straßenseite zu Straßenseite zwischen dem motorisierten Verkehr zählt übrigens auch als freundlicher Gruß, meist ist dann auch ein lautlos geformtes „Moin“ auf den Lippen abzulesen. Wenn derjenige in Eile ist, zum Beispiel. Selbst dann nimmt man sich die Zeit, kurz zu grüßen.
Ursprung des „Moin“
Wir halten fest: Unser direktes „Moin“ drückt norddeutsche Kultur, Gelassenheit und Herzlichkeit aus. Aber wo kommt sie denn nun her, diese besondere Grußformel? Tja, wenn das mal so einfach zu beantworten wäre. Für uns hier könnte man meinen, liegt der Ursprung im plattdeutschen Wort „moi“ oder im niederländischen „mooi“, was beides „schön“ oder „gut“ bedeutet. Der Duden sieht die Herkunft im ostfriesischen oder mittelniederdeutschen. Allerdings ist „moin“ auch in anderen Ländern und Regionen üblich, so zum Beispiel in Hamburg, Süddänemark und scheinbar auch in Teilen von Luxemburg, der Schweiz und Polen. Die wirklichen Wurzeln sind nach wie vor umstritten. Aber letztlich zählt ja auch nur eins: Dass das Wort „Moin“ nicht ausstirbt.
Ein herzliches „Moin“ an die Welt
So oder so gilt: Entgegen der häufig unterstellten spröden norddeutschen Art strahlt unser „Moin“ das genaue Gegenteil aus. Als Faustformel gilt: Wenn wir grüßen, kommt es von Herzen. Oder zumindest haben wir den Anstand, überhaupt zu grüßen. Nur wenn wir gar nicht grüßen und stumm vorübergehen, dann sollte man ins Grübeln kommen. In diesem Sinne: Ein „Moin“ an alle Leserinnen und Leser dieser Zeilen. Und das meine ich von Herzen.